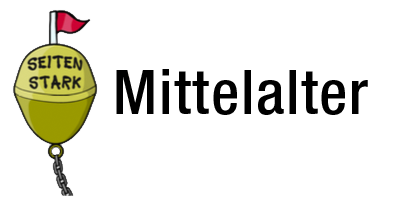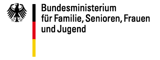Ritterliche Dichtung
|
Als Ritterlicher Dichtung werden in Deutschland mittelalterliche Texte bezeichnet, die im 12. und 13.Jahrhundert entstanden sind und die Lebens- und Denkweise des Ritterstandes zum Gegenstand haben. Die Ritterdichtung handelt von Kämpfen, Minne (Liebe) und ritterlichen Tugenden wie Selbstbeherrschung, Tapferkeit,Treue, Höflichkeit und Freigiebigkeit. |
Motive ritterlicher Dichtung

Illustration: Christian Ondracek
Ritter sind ähnlich sagenumwoben wie Dinosaurier und genauso ausgestorben. Die letzten moderne Rittergestalten wollen gewisse Militärhistoriker im Luftraum des Ersten Weltkrieges gesichtet haben: Piloten sollen sich damals im Himmel ritterliche Zweikämpfe mit Maschinengewehren geliefert haben.
Aber dem Piloten fehlt nicht nur die Rüstung. Zugegeben: der Ritter ist militärisch gesehen schwere Kavallerie, eine Menschmaschine aus Panzer, Schild und Lanze, ausgestattet mit einem PS, einer Pferdestärke – seinerzeit eine Wunderwaffe, der Propellermaschine des Ersten Weltkriegs in der Tat ähnlich. Auch den Zweikampf teilt er mit dem Piloten.
Im Mittelalter - seiner Epoche - gewinnt der Ritter obendrein durch einen Sieg nicht nur eine Tapferkeitsmedaille, sondern erstreitet damit auch Recht. Denn ein einfacher Soldat ist er nicht, behaupten jene Zeitgenossen, die seine Lebens- und Denkweise in Worte gefasst haben - die Ritterdichter.
In den Kampf zieht er wohl für seinen Lehnsherren, der seine Dienste nicht in Geld, sondern in Land aufwiegt, ihm Lehn zuteilt, das ihn ernährt.
Aber auf dem Schild des Ritters prangt keine Nationalflagge, vielleicht nicht einmal ein Familienwappen. Stattdessen baumelt an seinem Gürtel der abgeschnittene Rocksaum seiner Angebeteten, einer ungeheuer schönen Hofdame mit einem unaussprechlichen fantastischen oder französischen Namen wie Orgeluse oder Repanse de Schoye. Für die lohnt es sich zu kämpfen - und zu sterben – nicht für ein Vaterland.
Ritterliche Wirklichkeit
Dass es für die allermeisten Ritter beim Kämpfen und Sterben geblieben ist, ohne je für oder mit dieser Herzensdame zu leben, davon schweigen die Ritterdichter gerne.
Von dem unspektakulären Leben eines Ritters als Landverwalter, der von den Steuern lebt, die er seinen Untertanen abknöpft, berichten sie ebenso wenig wie von dem Gestank, den Krankheiten und der Brutalität, die dem Mittelalter den Ruf als dunkles Zeitalter eingebracht haben. Ritter sind selten die gepflegten Kavaliere (frz. Chevalier = Reiter) gewesen, als die sie sich gerne gesehen hätten. Ritter stinken bestialisch. Nach dem Schweiß des Schwert schwingenden Kriegers, nach Pferdeschweiß und nach dem Angstschweiß desjenigen, der in seiner schweren Rüstung unbeweglich auf dem Boden liegt und seinen Todesstoß erwartet.
Der Ritter hat von der Brutalität seiner Epoche gelebt, einer Zeit, in der das Faustrecht mehr galt, als jedes königliche Gesetz. Als „Freier Mann“ folgte er seinen eigenen Interessen. Unter den rivalisierenden Kriegsherren schwor er demjenigen Treue, von dem er sich die größten persönlichen Vorteile versprach. Als roher Klotz und Mordbrenner ist er etwa im 8. Jahrhundert in die Geschichte Europas eingetreten und als verarmter Raubritter hat er sich etwa im 14. Jahrhundert in ähnlich schlechtem Zustand daraus verabschiedet.
Aber dazwischen ist er lange Zeit Burgherr gewesen, der Herr jener Burg, in die sich Bauern und Handwerker vor feindlichen Überfällen flüchteten. Der Schutz, den der Ritter den Schwachen und Wehrlosen bot, dankten ihm die Bauern mit einem Teil der Ernte, die Dorfschmiede mit Schwertern und Schilden, die Schreiber mit Bewunderung.
Gezähmt aber hat den Haudegen des 8. Jahrhunderts die Kirche. Sie hat ihn zur Schutzmacht der Bevölkerung berufen, hat seine Waffen gesegnet und ihm Friedenseide abverlangt. Der Ritter ist diesem Ruf willig gefolgt. So hässlich scheint seine Lebenswirklichkeit gewesen zu sein, dass er dem Versprechen der Kirche auf ein besseres Leben nach dem Tod bald bedingungslos glaubte. So groß war die Macht des Glaubens, dass der Ritter als Gotteskrieger zu Kreuzzügen aufbrach, um Andersgläubige zu erschlagen, die er als Heiden schmähte. Das Paradies vor Augen verdurstete er auf dem Weg nach Jerusalem in der Wüste oder wurde von den Andersgläubigen selbst im Namen Gottes erschlagen.
Ritterliche Dichtung
In der ritterlichen Dichtung ist von dieser Alltagswelt und diesen Niederlagen des Ritters so gut wie nie die Rede. Er reitet frisch gewaschen von einem Kampf in den nächsten. Frieden ist ein flüchtiger Moment, in dem sich der Ritter für kommende Siege rüstet. Mag er seinem Lehnsherren auch treu dienen und den christlichen Glauben handfest verteidigen, sein Ehrgeiz und seine Träume speisen sich aus anderen Quellen.
Wie fast alles im Leben eines Ritters, so ist auch die Minne ein Wettkampf am Ritterhof. Der Streit um die süßesten Worte und schönsten Verse, ist allerdings nicht so leicht zu gewinnen wie ein gewöhnliches Turnier. Der Gegner ist weiblich, unbewaffnet, aber nicht wehrlos und gern widerspenstig. Der Ritter muss seine ganze Wortkunst und sein höfisches - oder wie wir heute sagen würden – höfliches Auftreten aufbieten, um sie zu erobern. Nach Jahrhunderte langem Schattendasein in der Literatur der Mönche und Klöster, entfalten die Frauen in der ritterlichen Dichtung eine ungeheure Macht – als Publikum. Flugs verwandelt sich das Kampfgeschrei des Schlachtfeldes in die romantischen, zuweilen kitschigen „Schlager“ des Minnesangs.
Das Glanzvollste an Rittern sind also nicht ihre funkelnden Rüstungen, die haben schon römische Legionäre getragen. Es sind die Verse, die ihre strahlend schönen Frauen und ruhmreichen Heldentaten besingen. Kein Wunder, dass der echte Ritter, der historische, dem Charme des eigenen Ritterideals genauso erliegen musste, wie viele, die sich später mit dem Rittertum beschäftigt haben.
Dichtung und Wahrheit lassen sich schwer auseinander halten, denn heute wie damals stammte der Bärenanteil dessen, was wir über den Ritter wissen, aus der Feder seiner Barden, der Hofdichter.
Berühmte Helden der Ritterdichtung
Frauen sind natürlich nicht die einzigen Schätze, denen der Ritter auf seinen Abenteuern hinterher jagt. Er schätzt genaugenommen alles, was glänzt, solange auf dem Weg dahin Gefahren zu bestehen sind.
Siegfried
Der Nibelungenschatz beispielsweise ist so ein glänzender Berg aus edlem Metall und bunten Steinen, der geborgen werden will. Er taucht im Nibelungenlied auf, einem Versroman, den ein unbekannter Dichter aus den Stoffen der germanischen Sagenwelt gewoben hat. Sagen, mündlich oder bruchstückhaft schriftlich überlieferte Geschichten aus der Zeit der Völkerwanderung, sind die meist nüchtern erzählten Vorlagen für die literarischen Abenteuer der Ritterdichter.

Illustration: Christian Ondracek
Jeder Schatz hat seinen Hüter und ein feuerspeiender Drache ist bei weitem nicht die schlimmste aller vorstellbaren Möglichkeiten. Der Nibelungenschatz wird von einem Zwerg namens Alberich bewacht, der eine Tarnkappe besitzt, die unsichtbar macht. Einen Zweikampf gegen einen Unsichtbaren zu gewinnen, ist nicht jedem Ritter vergönnt, dem bärenstarken Siegfried schon. Er überwindet und unterwirft Alberich – und schenkt ihm das Leben. Das ist die edle Gesinnung, die den Ritter ehrt und vom gewöhnlichen Räuber unterscheidet. Und es macht sich bezahlt. Alberich schwört Siegfried Treue und selbst Zwerge sind im Nibelungenlied ritterlich genug um sich an Treueschwüre zu halten.
Siegfried lassen die Reichtümer, die sich vor seinem Augen ausbreiten, kalt. Habgier mag die Sache von ritterlichen Zwergen sein, zu den Rittertugenden zählt sie nicht. Statt Reichtum, gilt es Ehre anzuhäufen. Also greift sich Siegfried aus dem Schatz das heraus, was einem fahrenden Ritter behilflich sein könnte, ein Schwert und natürlich die Tarnkappe.
Für Schwerter haben Ritter eine berufsmäßige Schwäche, besonders wertvolle Exemplare tragen sogar Kosenamen. Im Nibelungenschatz befindet sich eines, das auf den Namen Balmung hört. Siegfried wird damit einen Drachen erschlagen und noch so manchen Schädel spalten, bevor er hinterrücks von einem niederträchtigen Gegner namens Hagen ermordet wird. So eine Schandtat kann ein Ritterdichter nicht dulden. Als ritterlich gilt der faire Zweikampf von Angesicht zu Angesicht bei gleichen Waffen. Hagen büßt sein ehrloses Verhalten daher einige hundert Verse später mit dem Leben.
Die Ritter der Tafelrunde von König Artus
Da ist noch ein zweites namhaftes Schwert, das in der Dichtung dazu bestimmt ist, die Rittertugenden zu verfechten. Excalibur, das Schwert von Artus, dem König der Tafelrunde. Diese alte keltische Sage hat die Fantasie der Ritterdichter noch stärker entflammt als die germanische Sagenwelt Siegfrieds und die höfische Gesellschaft, die den Ritter umgab, ganz in ihren magischen Bann gezogen.
Feen und Zauberer mischen sich darin unter eine Schar edler Ritter, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Armen und Schwachen zu schützen und Recht und Ordnung zu verteidigen. Um zur Tafelrunde zu gehören, genügt es nicht einfach auf Abenteuer auszureiten und mit heiler Haut davon zukommen. Der Ritter muss edle Taten vollbringen. Die Abenteuer wollen bestanden werden wie Prüfungen, Mut allein reicht nicht, Edelmut soll es sein und Dienst. Unter Dienst verstehen diese Ritter den Kampf für das Gute. Was das ist, beratschlagen sie in der Tafelrunde. Hinweise suchen und finden sie in der Bibel und passen es der Welt des Ritters an:
Gerechtigkeit ist gut, also gilt es Unrecht zu rächen. Leistung ist gut, also gilt es Gefahren nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sich ihnen zu stellen. Erziehung ist gut, denn sie verfeinert die Sitten. Lebensfreude ist gut, also heben die Ritter den Becher mit Wein und lachen dem Tod ins Gesicht.
Parzival

Illustration: Christian Ondracek
Wolfram von Eschenbach hat zwei Rittern der Tafelrunde im Parzival ein Denkmal gesetzt.
Der eine, Parzival selbst, bricht - noch halb Kind - auf, um Ritter zu werden. Seine Reise beginnt er als Tölpel, unwissend, ohne Benehmen und in einem Narrenkleid – sein Ziel ist der Artushof.
Wonach muss einer suchen, der Ritter werden will? Zunächst muss er lernen, sich wie ein Ritter zu benehmen. Seine Lehrjahre verbringt so ein Halbstarker üblicherweise als Knappe, als Gehilfe eines Ritters, als Lanzenträger, Stallbursche und Sendbote seines Lehrmeisters. Das dauert einige Jahre und gipfelt im Ritterschlag, dem entscheidenden Moment im Leben eines werdenden Ritters. Knieend wird ihm das Schwert auf die Schulter gelegt. Dann bekommt er einen Faustschlag ins Gesicht - den letzten in seinem Leben, den er nicht vergelten darf. Diesen Schlag muss er einstecken, ohne eine Miene zu verziehen. Selbstbeherrschung ist die Rittertugend, die aus einem Jungen einen Krieger macht.
Der Hitzkopf Parzival hat von all diesen Dingen allerdings nicht die leiseste Ahnung. Seine Antwort auf die Frage, was einer suchen muss, der Ritter werden will, ist simpel und dreist, aber nicht ganz falsch: Er braucht eine Rüstung, ein Schwert und ein Pferd.
Parzival staunt nicht schlecht, als ein Ritter in roter Rüstung seinen Weg kreuzt. Die will er haben! Den Ritter hinter dem Harnisch fürchtet er nicht. Dennoch - und das ist sein Glück – beherrscht er sich und fordert den roten Ritter nicht gleich zum Zweikampf heraus. Stattdessen grüßt er ihn freundlich und bekommt von dem Ritter die Aufgabe aufgetragen, eine Botschaft an König Artus zu überbringen. Als Sendbote setzt er seinen Weg zum Artushof fort. Er überbringt die Nachricht, verlangt aber im selben Atemzug lautstark die Rüstung seines Auftraggebers. Die Ritter der Tafelrunde sind baff. Ist das Benehmen dieses Jungen im Narrenkleid nun unverschämt und damit eines Ritters nicht würdig oder eher unerschrocken und damit ritterlich im besten Sinne?
Ritter tun sich durch Taten hervor, nicht durch Worte. Soll er seinen Zweikampf haben, gebietet Artus.
Parzival lässt sich nicht lange bitten. Nur mit einem Sauspieß bewaffnet, stellt er den roten Ritter, fordert ihn heraus und erschlägt ihn. Das ist ritterlich gehandelt und auch wenn Parzival noch weit davon entfernt ist, in die Tafelrunde aufgenommen zu werden, den Ehrentitel Roter Ritter wagt ihm keiner mehr streitig zu machen.
Gawan
Der zweite Ritter, dessen Abenteuer Wolfram von Eschenbach in seinem Versroman verfolgt, ist das exakte Gegenteil des unfertigen, aber kühnen Parzival. Er heißt Gawan, tritt vom ersten Augenblick an als Edelmann auf, besitzt Ehre, Anstand, Bildung und versteht etwas von Minne und guten Sitten.

Illustration: Christian Ondracek
Einfache Zweikämpfe bringen so einen alten Kämpen nicht mehr aus der Fassung, die widerspenstige Orgeluse, eine freiheitsliebende Rittersfrau, die seine Manneskraft verspottet und für seine Minne unempfänglich ist, stachelt allerdings seinen ritterlichen Ehrgeiz an. Will er ihre Zuneigung gewinnen, muss er Klingsor besiegen, einem finsteren Zauberer, dem mit gewöhnlichen Waffen nicht beizukommen ist. Gawan dringt in Klingsors Schloss ein und gerät in eines der sonderbarsten Abenteuer der mittelalterlichen Ritterdichtung: den Zweikampf mit einem magischen Bett. Den Zauber des magischen Bettes mit dem Gawan zu tun hat, kann nur brechen, wem es gelingt, hinein zu steigen. Das Bett ist flink wie ein Wiesel und rast wie ein Eishockey-Puk über den spiegelglatten Boden des Schlosses. Gawan fasst Mut und springt. Er landet weich. Das Bett bäumt sich in einer wilden Achterbahnfahrt noch einmal auf und bleibt endlich stehen. Gawan hat es geschafft. Orgeluse ist endlich sein.
Formen der ritterlichen Dichtung
Die Verse über die Abenteuer von Parzival und Gawan sind im Mittelalter so etwas wie die Abenteuer von Harry Potter heute. Buchdruck gab es damals nicht und damit keine Bestseller, aber die Geschichte wurde hundertfach handschriftlich abgeschrieben - abgewandelt, ausgemalt und neu bearbeitet.
Mehrere tausend Verse hat allein Wolfram von Eschenbach zu zwei Versromanen gereimt, ein literarisches Programm, das mehrere Abende füllte.
Und er war weder der erste noch der letzte, der diesen Rittern ein Werk widmete. Entsprechend vielfältig und wandelbar sind diese Texte, Versmaß und Schreibstil variieren je nach Autor, der versuchen musste, sich durch die eigenwillige Verarbeitung des immergleichen Stoffes einen Namen zu machen.
Die Form des Versromans brach aber eigentlich erst derjenige, der seine Verse nicht las, sondern den Vortrag zur Laute bevorzugte, einer der sang. Er besang die Schönheit der Frauen und er tat das in der Form von Gedichten, die er auf der Laute begleitete, er schrieb Lieder, die Gefühle ausdrückten, also Lyrik. Diese Liedesdichter werden Minnesänger genannt und die größten unter ihnen haben es so weit gebraucht, das sie die Form des Minnesangs beibehaltend, aber der Schönheit der Frauen augenscheinlich überdrüssig andere Themen in ihren Liedern zu Gehör brachten.
Walther von Vogelweide war so einer und nichts lag ihm ferner als einfach die Abenteuer kämpfende Ritter zu besingen. Da gab es politische Lieder, die Ritter zur Teilnahme an Kreuzzügen aufforderten oder die politischen Verhältnisse verspotteten. In der Tradition der Troubadore reisten andere von Ritterhof zu Ritterhof und sangen die neuesten Nachrichten, denn Zeitung und Fernsehen waren ja noch nicht erfunden.
Was ihnen allen gemeinsam ist und keine Vorläufer hat, ist die Sprache, in der sie reimten und sangen: Das Mittelhochdeutsche.
Schrift und Wort waren Jahrhunderte lang Sache von Spezialisten gewesen, die in lateinischer Sprache dachten und schrieben. Die Ritterdichter brachen mit dieser Tradition. Das Volk sollte ihre Stimme hören und so haben sie der deutschen Sprache und Kultur mächtig auf die Sprünge geholfen.
Links
http://www.deutschonline.de/Deutsch/Ritterdichtung/Ritterdichtung.html
http://www.blinde-kuh.de/ritter/
http://www.trompis-zeitreise.de/Mittelalter.html
http://www.junge-klassik.de/Vor-500-Jahren.html
Quellenangabe
Willst du diesen Lexikonartikel in einer schriftlichen Arbeit zitieren? Dann kannst du diese Quellenangabe verwenden:
-
Ondracek, Christian: Ritterliche Dichtung. In: Rossipotti-Literaturlexikon; hrsg. von Annette Kautt; https://www.literaturlexikon.de/epochen/ritterliche_dichtung.html; Stand: 14.02.2018.